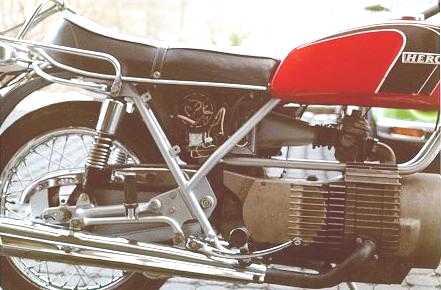Meine zweite Hercules
Wankel 2000 (gekauft 2001) Zurück
zur Auswahlseite Wankel 2000
Wie bereits zu meiner ersten
Hercules Wankel 2000 beschrieben, hatte ich mich im April 1979 nicht leichtfertig
von der Maschine getrennt. Hinzu kam, dass sich mein damaliger Neuerwerb (BMW
R 100 RS, Modell 1976) eher wie ein Traktor auf zwei Rädern fuhr. Nichts von
einem seidenweichen Fahrverhalten, sondern eine ruppige Trockenkupplung mit
einem antiquarisch zu schaltenden Getriebe! Auch bei Kurvenfahrt vermittelte
der quer zu den Rädern laufende Boxermotor eine gewisse Ehrfurcht. Viel zu oft
teilte die BMW einem mit, dass man sich bereits gefährlich der Schleuder- und
Rutschgrenze näherte, obwohl man gar keine extreme Schräglage fuhr! Dazu kam
eine Sitzbank mit schlechtem Komfort, eine ungünstige Körperhaltung wegen des
Sportlenkers, usw. Allenfalls zum Schnellfahren taugte das Ding, wobei dann
die Kreuz- und Handgelenkschmerzen erträglich blieben. Bei Stadtfahrten heizte
der Motor den Bereich hinter der Verkleidung zumindest im Sommer kräftig auf,
so dass einem fast das Wasser aus den Stiefeln lief. Es dauerte einige Wochen,
bis ich mich halbwegs daran gewöhnt hatte. Trotz dieses bis heute gebliebenen
Eindrucks fahre ich nach rund 15 Jahren Pause heute wieder einen BMW-Boxer (R
65 RT, Modell 1981). Dies allerdings hauptsächlich, weil diese Maschinen recht
wartungsarm und zuverlässig sind und die meisten Reparaturen in Eigenregie ausgeführt
werden können.
Im Herbst 2000 sah ich dann beim Besuch eines Oldtimer-Treffens
in Flammersfeld/Ww. nach langen Jahren wieder eine Wankel 2000. Die Maschine
entsprach exakt meinem 1975er Modell, hatte nur rund 1.675 Km auf dem Tacho
und wirkte insgesamt so gut gepflegt, als sei sie im ladenneuen Zustand. Der
Verkäufer stellte sich knapp 7.000 DM als Preis vor, "Verhandlungen"
schienen ziemlich aussichtslos. Eine Woche nach dem Treffen rief ich ihn an
und erkundigte mich nochmals nach der W 2000. Sie war bereits überraschender
Weise während des Treffens verkauft worden! Damit war der "Wankel-Bazillus",
der die ganzen Jahre wohl eher nur geruht hatte, in mir wieder zum Leben erweckt!
Nach einigen Wochen entdeckte ich eine weitere W 2000 (Oil-Injection) im Besitz
eines Sachs-Händlers im nördlichen Westerwald, der sie jedoch für eigene Zwecke
restauriert hatte und behalten wollte.
Als nächstes fragte ich bei dem
BMW-Händler nach, der damals meine W 2000 in Zahlung genommen hatte. Er konnte
sich noch an mein Motorrad erinnern, wusste aber nichts mehr über dessen Verbleib.
Wie ich wusste, hatte er damals selbst auch eine Wankel, die er von 1975 bis
1976 als Vorführmaschine einsetzte. Ich fragte ihn deshalb auch nach dem Verbleib
seiner eigenen Maschine: Nachdem sich das Publikumsinteresse schon damals mehr
den typischen Reihenvierzylindern zuwandte, führte diese W 2000 ein Schattendasein
und wurde nur noch sehr selten mit rotem Kennzeichen bewegt. Irgendwann so um
1977/78 verschwand sie dann in den unergründlichen Tiefen seines Gebrauchtmotorradlagers
und hat wohl später den Ruf, dort die längste Dienstzeit erreicht zu haben,
bekommen. Insgesamt hatte sie nur knapp mehr als 3.500 Km gelaufen. Zudem war
der Motor wegen Ölkohleablagerungen damals bei Sachs überholt worden und sollte
seitdem nur ca. 100 Km benutzt worden sein. Einen Verkauf plante er aber nicht.
Ich bat ihn, mich zu informieren, falls er sich dies anders überlege.
Nachdem ich gut ein Jahr nichts
mehr davon gehört und die Angelegenheit eigentlich schon fast vergessen hatte,
fragte er mich im Oktober 2001, ob ich an der W 2000 noch interessiert sei.
Ich habe mir die völlig eingestaubte Maschine angesehen und spontan entschieden,
sie zu kaufen. Allerdings konnten wir anfangs keinen gemeinsamen Nenner für
den Preis finden. Etliche Male fuhr ich zu Nachverhandlungen bei ihm vor, bis
dann Handelseinigkeit erzielt wurde. Die W 2000 verlud ich sofort auf ihren
platten Reifen auf meinen Anhänger und brachte sie in ihre neue Heimat. Die
gröbsten Schäden waren mir bereits vor dem Kauf aufgefallen: starke Innenkorrosion
des Tanks, vordere Bremsanlage fest korrodiert und Leck im Nachfülldeckel, Batterie
und Reifen und etliche Gummi-Kleinteile "tot", Vergaser verharzt,
Rahmen teilweise leicht angerostet, kleine Beule im Schutzblech, usw. Aber wenigstens
fehlte bis auf die Lenkerschlüssel und die Betriebsanleitung kein Teil! Selbst
der Werkzeugsatz war noch vorhanden! Zudem hat die Maschine die Fahrgestell-Nr.
480 000 329 und liegt somit nur 20 Fahrzeuge von meiner früheren W 2000 entfernt!

Anreise auf dem Anhänger - Hercules-Gespann der
besonderen Art

|
Zu
Hause wollte ich zuerst mal den Motor probelaufen lassen. Der Tank wurde
abgebaut, stattdessen ein Trichter als Minibehälter mit Gemischfüllung am
Benzinschlauch angeschlossen. Nach dem provisorischen Verbinden einer Autobatterie
ließ ich den Anlasser bei heraus geschraubter Zündkerze drehen, um die Motorschmierung
zu aktivieren und alte Gemischreste aus den Brennräumen zu blasen. Nach
dem Wiedereinbau der Kerze gab die W 2000 leider außer einem kurzen Husten
keinen Mucks von sich. Ich wiederholte daher den Vorgang etliche Male, bis
ich irgendwann entnervt aufgab. Trotz des vorhandenen Zündfunkens ließ sich
der Motor nicht starten. Ich nahm an, der Zündfunke sei zu schwach und untersuchte
am folgenden Tag die komplette Zündanlage, nachdem ich mir einen Polradabzieher
gebaut hatte. Fehler fand ich an der Zündung nicht, selbst der über 20 Jahre
alte Kontaktsatz war vollkommen in Ordnung. Den Vergaser hatte ich bereits
vor dem ersten Startversuch von den vorhandenen Ablagerungen, die sich nicht
im Düsensystem, sondern nur in der Schwimmerkammer befanden, befreit. Da
konnte also wohl die Ursache auch nicht liegen!
Nachdem
ich so nicht weiter kam, nahm ich mir den Vergaser nochmals vor. Ich hatte
die kleine Bohrung in der Schwimmerkappe, die den Kraftstoff für den Startkanal
zuführt, übersehen. Diese war total verstopft. Zum Testen baute ich dann
mal die rechte Schwimmerkappe meiner BMW R 65 unter den Wankel-Vergaser.
Einmal kurz anlassen - der W-2000-Motor sprang an, als hätte er erst seit
einem Tag gestanden! Der Motor nahm sofort sauber Gas an, zeigte keine
mechanischen Nebengeräusche und schien die lange Pause gut überstanden
zu haben. Allerdings konnte man mit der notdürftigen Gemischfüllung keine
Probefahrt machen.
|
Hercules nach der Ankunft zu Hause -
angestaubt und angerostet ...
Die Bereifung ist original Werksauslieferung von 1974! |
|
Daher musste als nächstes Projekt
erst einmal der Tank saniert werden - eine Kraft zehrende und langwierige Prozedur.
Der Tank wurde vom Benzinrest befreit und mit Kaltreiniger-Wasser-Spüli-Gemisch
vorgespült. Dann spannte ich den in einen Plastiksack verpackten Tank mit Gummibändern
auf eine Betonmischmaschine. Zuvor kam eine Schaufel feiner Sand in den Tank.
Die Mischmaschine ließ ich danach gut eine Stunde laufen. Leider war die Sandfüllung
wenig funktionell, für den nächsten Arbeitsgang tauschte ich den Sand gegen
Feinsplitt aus, wodurch eine wesentlich bessere Schleifwirkung eintrat. Allerdings
konnten nur die Flächen, die vom Splitt bei jeder Maschinenumdrehung erreicht
wurden, gereinigt werden. Die anderen Tankbereiche blieben von meiner Aktion
ziemlich unbeeindruckt. Ich entschied mich daher, die Aktion durch Handarbeit
(Schütteln) fortzusetzen, da ein Aufspannen mit geänderter Drehrichtung ohne
Beschädigung der Tanklackierung nicht durchführbar erschien. Das Schütteln ist
sehr anstrengend und zeitaufwendig - ich verteilte es stundenweise auf mehrere
Abende. Am Ende trat ein einigermaßen akzeptabler Erfolg ein. Danach wurde der
Tank mit einem handelsüblichen Tankreinigungs-, Entrostungs- und Versiegelungsset
weiter bearbeitet und gut eine Woche zum Trocknen im warmen Heizraum untergebracht.
Während der Trocknungsphase begann
ich erste Arbeiten an der vorderen Bremsanlage, die zerlegt wurde. Hier erwiesen
sich Bremssattel, Bremsscheibe und Bremszylinder als stark korrodiert. Alle
Bremskolben klemmten in den Schächten. Eine Instandsetzung schien mangels passender
Dichtringe und notwendiger neuer Dehnschrauben (Sattel) wenig durchführbar.
Durch ein Mitglied der Wankel-Interessengemeinschaft gelang es mir, die benötigten
Teile aufzutreiben, nachdem ich zeitweilig bereits ernsthaft erwogen hatte,
eine komplette Telegabel der BMW R 45 in die Wankel zu verpflanzen.
Wie bereits geschildert, war die
Materialwahl der ersten Variante der W-2000-Bremsscheibe nicht gelungen: sie
war insgesamt stark korrosionsgefährdet, der Rost setzte dem Bremssattel stark
zu und führte zu Bremsenklemmern, verbunden mit vorzeitigem Belagverschleiß
und Sturzrisiken! Problematisch ist insgesamt die Konstruktion der aus Italien
stammenden Grimeca-Vorderradbremse, die exklusiv für Hercules und hier auch
nur für die W 2000 gefertigt wurde! Am Bremssattel sind zwischen Bremsklötzen
und Bremskolben keine Staubschutzmanschetten eingebaut. Zudem tummeln sich Bremskolben
und Belag in der gleichen Schachtebene, wodurch besonders viel Schmutz und Feuchtigkeit
auf die Dichtmanschettenbereiche gelangt. Auch der Handbremshebel ist unzureichend
mit dem Bremszylinder verbunden. Der dafür eingesetzte Druckbolzen wird nur
durch den Druck der Rückstellfeder des Bremskolbens und zusätzlich durch einen
schnell alternden Gummibalg an seinem Platz gehalten. Er kann unter ungünstigen
Bedingungen während der Fahrt herausfallen, so dass die Bremse wirkungslos wird!
Ferner benötigte ich noch ein kurzes
Stück Bremsschlauch, da ich einen Zwischenflansch für den Anbau eines vorderen
Bremslichtschalters nachrüsten wollte. Ja, Sie haben richtig interpretiert:
die ersten W 2000 hatten für die Vorderradbremse kein Bremslicht, sondern nur
für die Hinterradbremse! Zudem gab es keine Standlicht-Schaltung ab Werk! Für
beides ist eine Nachrüstung sehr sinnvoll.
Die vordere Bremsanlage wurde total
zerlegt, gereinigt und schadhafte Teile (Bremszylinder) wurden gegen die jetzt
vorhandenen Neuteile gewechselt. Ich montierte zwischen Bremsschlauch und Zylinder
ein T-Stück, das über einen zweiten, kurzen Bremsschlauch (stammt von der Käfer-Hinterachse)
angeschlossen wurde. Am T-Stück wurde ein Bremslichtschalter vom PKW montiert.
Alles fand seinen Platz unauffällig zwischen den Lampenhaltern, die zudem neu
lackiert wurden (Felgensilber mit sofortigem Klarlacküberzug erwies sich hier
als eine dem Originalfarbton RAL 9006 nahezu identische Mischung). Allerdings
ergab sich durch das T-Stück ein kleiner Nachteil, da der originale Bremsschlauch
für diese Montagesituation etwas zu lang ist. Die kürzere Variante von der W
2000 Injection wäre hier die bessere Lösung, war aber nirgendwo aufzutreiben.
Ich fand dann passenden Ersatz in Form eines Bremsschlauches von einer Hercules
Ultra II.
Anfang November 2001 war es soweit:
der Tank durfte seinen Platz wieder auf der Maschine einnehmen. Anschließend
konnte ich den Motor, der beim ersten Start eine hässliche Rauchwolke von sich
gab, mal etwas ausgiebiger probeweise laufen lassen und das Motorrad in der
Grundstückseinfahrt ein paar Meter bewegen. Das zufrieden klingende "Brabbeln"
des Wankelmotors übertrug sich dann gleich auf meine innere Stimmung. Allerdings
hatte sich wegen der Vergaserdemontage eine Undichtigkeit am Anschluss-Stutzen
(Runddichtring) ergeben. Einen neuen Ring hatte ich nicht zur Hand. Ich stellte
fest, dass ein Vergaserflansch- Anschlussgummi inkl. Schlauchbinder der BMW-Boxer
R45/65/80 stattdessen passt, wenn man den eingeklebten Blechstutzen vom Vergaser
des Sachs-Motors entfernt. Diese Art der Abdichtung ist übrigens konstruktiv
wesentlich besser als das Sachs-Original. Zudem wird die Neigung zur Vergaservereisung
bzw. Überhitzung verringert (Wärmebrücke, da Gummi Wärme schlechter leitet als
das blanke Metall).
Neue Schwierigkeiten ergaben sich
bei der Prüfung der Lenkkopflager. Die Lager wiesen in Geradeaus-Stellung der
Lenkung eine Druckstelle aus. Sobald der Lenker eingeschlagen wurde, nahm der
Widerstand in der Lenkung spürbar zu. Eine Demontage war also unvermeidbar.
Zudem musste die gealterte Fettfüllung sowieso erneuert werden. Das untere Lenkkopflager
hatte etliche Riefen, eine Reparatur des Lagers schied aus. Anzumerken ist,
dass es sich um Axial-Rillenkugellager handelt, deren Kugeln ohne Führungskäfig
in den Lagerschalen "schwimmen". Das obere und untere Lager ist gleich
und trägt die SKF-Nummer 350249.
Eine Anfrage bei SKF ergab, dass
solche Lager seit Jahrzehnten bereits nicht mehr hergestellt werden. Bestände
waren nicht verfügbar. SKF lag lediglich noch eine Konstruktionszeichnung vor,
aus der jedoch z. B. die Belastbarkeitsdaten nicht erkennbar waren. Bei der
Recherche nach vergleichbaren Standard-Lagern ermittelte ich den Lagertyp 51106
als ähnlichstes Bauteil. Dieses Lager weicht nur hinsichtlich des Außendurchmessers
(Hercules = 48 mm, 51106 = 47 mm) ab und ist preiswert erhältlich. Die Belastungsgrenze
axial liegt bei 35 kN, was nach Angaben von SKF für Lenkköpfe kleinerer Motorräder
ausreichend ist.
Den geringeren Lagerdurchmesser
kann man durch Einkleben eines Blechringes (Blechstärke 0,5 mm, Klebstoff z.
B. Loctite 648)) in den Lagersitz der W 2000 ausgleichen. Ich entschied mich
dafür, das verbliebene intakte Originallager von der Oberseite des Lenkkopfes
auf die Unterseite umzubauen, weil dort die höhere Belastung anzunehmen ist.
Auf der Oberseite traf ich Vorbereitungen für den Einbau des Blechringes und
des Lagers 51106. Durch Zufall entdeckte ich bei weiteren Recherchen im Web
und Zeitschriften jedoch die Anschrift eines Lagerlieferanten, der noch über
eine kleine Stückzahl des Original-Lagers 350249 verfügte, so dass der Umbau
dann doch noch entfallen konnte.
Die gelieferten Originallager sind
übrigens wohl exklusiv für Hercules mindestens seit Anfang der 1960er Jahre
bei SKF produziert worden. Meine neuen Lager waren absolut luftdicht verpackt
und hatten einen Beipackzettel mit einer BW-Versorgungsnummer (3110-12-122-6760)
und ein Produktionsdatum 02/1962! Es müsste demnach in alten Bundeswehrbeständen
ggf. noch weitere Vorräte davon geben. Der Lagertyp ist wahrscheinlich auch
bei der K 100, K 125 BW und K 125 T/S als unteres Lenkkopflager eingebaut worden!
Schon bei der Demontage der alten
Lager war mir aufgefallen, dass je 18 Kugeln eingebaut waren, dazwischen aber
noch Platz für eine weitere Kugel verblieb. Meine Vermutung bestätigte sich,
als ich die neuen Lager auspackte: diese haben 19 Kugeln. Entweder hat man bei
der Montage meiner W 2000 im Werk bereits einen Fehler gemacht oder die beiden
fehlenden Kugeln sind später bei einer Inspektion verloren gegangen. Hieraus
erklärt sich aber auch generell der Schadenseintritt! Vergleichbare Mängel an
der Lenkkopflagerung waren bei meiner ersten W 2000 nämlich nie eingetreten.
Der für den Dauereinsatz mit einer
"leistungshungrigen" H-4-Glühlampe nicht unbedingt konzipierte, vom
Moped stammende Fernlichtschalter wurde nächstes Opfer meiner Überlegungen:
Im Lampengehäuse fand ein Fernlichtrelais vom VW-Käfer hinreichend Platz. Der
Geber des Relais wurde dann mit dem bisherigen Druckschalter der Hupe verbunden
(jetzt gleichzeitig mit Lichthupenfunktion). Am Fernlichtschalter dient jetzt
eine Position gemeinsam für Fahr- und Fernlicht, die andere Schalterstellung
ergibt eine Standlichtschaltung. Als neuer Hupenknopf fungiert der bisherige
Anlasserknopf. Für den Anlasser wurde ein separater Druckschalter (vom Traktor)
unauffällig unterhalb der oberen Lenkerbrücke montiert.
Ferner stellte ich einen Versteifungsbügel
zur Montage zwischen den beiden Tauchrohren der Telegabel aus einem Stück verzinktem
Blech her (ca. 1,5 mm stark - ähnlich wie bei den BMW-Zweiventil-Boxermodellen).
Damit soll die Führung der Tauchrohre verbessert werden. Gleichzeitig wanderte
das vordere Schutzblech inkl. Halter ca. 2 cm nach oben. Durch diese Änderung
erreichte ich, dass alternativ ein Reifen der Größe 3.25 -18 ohne weitere Modifikation
montiert werden kann. Die Umrüstung von 3.00-18 vorne und 3.25-18 hinten auf
3.25-18 vorne und 3.50-18 hinten ist nicht nur zur Verbesserung des Fahrkomforts
sinnvoll, sondern auch im Hinblick auf die heutige Verfügbarkeit von Reifenprofilen.
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung steht mir zumindest für das Hinterrad noch
von meiner ersten W 2000 zur Verfügung. Von Mitgliedern der Hercules Wankel-Interessengemeinschaft
habe ich jedoch erfahren, dass auch andere Reifengrößen bis zu 3.60-18 (vorne)
in Verbindung mit 4.10-18 (hinten) eingetragen werden, ggf. auch moderne Niederquerschnittsreifen.
Nachdem meine Maschine Anfang Dezember
2001 ihre ersten Runden in der Grundstückseinfahrt erfolgreich absolviert hatte,
stand die Überarbeitung von Hinterrad/hinterer Rahmenpartie und der Wechsel
von Getriebeöl und Reifen an. Die Räder erhielten neue Metzeler-Reifen/Schläuche
(3.25-18 und 3.50-18), der Chrom an Felgen und Schutzblechen der Räder wurde
ausgiebig poliert. Aufgrund eines Warnhinweises der Hercules Wankel Interessengemeinschaft
kontrollierte ich beide Felgen auf überstehende Speichen im Felgenbett, die
in Einzelfällen bei den W 2000 festgestellt worden waren. Einige tatsächlich
überstehende Speichen kürzte ich durch Nachschleifen entsprechend ein, damit
Felgenbänder und Schläuche nicht beschädigt werden können.

Demontagearbeiten vor der Rahmenlackierung

Der Rahmen vor dem Lackieren
|
Auf
eine Komplettzerlegung des Motorrades verzichtete ich wegen des relativ
guten Gesamtzustands aller Fahrwerksteile. Motor, Getriebe und Kabelbaum
blieben also an ihrem Platz. Alle anderen Teile inkl. der Hinterradschwinge
wurden vom Rahmen abgebaut. Die leicht angerosteten Zonen des Rahmens (hier
insbesondere im Bereich von Schweiß- und Lötverbindungen) wurden manuell
abgeschliffen und entgratet. Anbauteile und Schwinge erhielten eine Neulackierung
mit Felgensilber aus der Sprühdose, nach dem Antrocknen eine zweite Schicht
Klarlack.
Der Rahmen wurde komplett
mit weißem Auto-Filler gestrichen und anschließend gründlich mit 400er
Papier geschliffen. Danach erfolgte (und jetzt bitte die Originalfetischisten
nicht weiter lesen ...) eine Beschichtung mit dünnflüssigem Acrylharz-Autolack
(silber RAL 9006) mittels einer kleinen Rolle und
einem Schaumstoffpinsel.
Diese
Art der "Lackierung"
entspricht zwar nicht dem Hochglanzerfordernis einer Werkstattarbeit,
jedoch stellte es sich als einfachste und preiswerteste Variante dar.
Streichspuren entstehen dabei nicht, wenn man die Teile erst vorrollt,
kurz antrocknen lässt und danach nochmals gründlich mit etwas mehr dünnflüssigem
Material nachrollt. Ecken und Kanten lassen sich mit dem Schaumstoffpinsel
oder ggf. einem Malpinsel erreichen, so dass ein vollständiger Überzug
möglich wird. Für einen Motorradrahmen gelten sowieso normalerweise nicht
die Hochglanzerfordernisse wie z. B. bei der Tanklackierung. Zudem findet
sich so leicht kein Lackierbetrieb, der diese Arbeiten zu einem akzeptablen
Preis überhaupt professionell ausführen will. Letztlich reagiert das Auge
gerade beim Silberfarbton der Hercules relativ unsensibel bezüglich der
Hochglanzoptik, anders als z. B. bei einem dunklen Farbton.
|

Auswechseln der Lenkkopflager und Einbau vorderer
Bremslichtschalter |
Nach Abschluss dieser Malerarbeiten
widmete ich mich ausgiebig der Herstellung eines besseren Kettenschutzes.
Zwar gab es in den 1970er Jahren vereinzelt Umbauten mit einem geschlossenen
Becker-Fettkettenkasten, ich wählte aus Kostengründen jedoch eine etwas
profanere Lösung: Der Original-Kettenschutzbügel wurde auf der Radseite
durch ein angeschraubtes Blechteil nach unten verlängert.
Es wurde ein Stück Alublech
(aus Dachdecker-Zubehör) mit 1,0 mm Stärke nach einer vorher hergestellten
Kartonschablone geschnitten, die Unterkante zweifach gebördelt und dann
mit vielen Versuchen auf das Endmaß angepasst. Für den Kettenradbereich
wurde ein zusätzliches Blechstück geformt. Die Kette ist jetzt zum Rad
hin abgeschirmt, Schmutz und Wasser werden ferngehalten. Zudem wird auch
wesentlich weniger Schmiermittel vom Kettenrad auf die Felge abgeschleudert.
Die Kette ist aber nach wie vor zu Wartungs- und Einstellarbeiten gut
erreichbar.
|
Mit dem eigentlichen Zusammenbau
der Maschine begann ich Anfang Januar 2002, wobei außerdem noch wichtige Änderungen
an der Verkabelung durchgeführt wurden. Zur Vorbereitung für späteren Umbau
auf verstärkte Lichtanlage und elektronisch gesteuerte Batteriezündung hielt
ich den originalen Bosch-Brückengleichrichter für unzureichend. Dieses Teil
ist unmittelbar hinter dem Rahmenkopf zwischen den Knotenblechen eingebaut,
sehr schlecht zugänglich und thermisch überfordert, da kaum Kühlluft dorthin
gelangt. Nach einigen Vorüberlegungen kam ich zu dem Ergebnis, dass ein Drehstromgleichrichter,
wie er in PKW-Lichtmaschinen verbaut wird, durchaus eine taugliche Alternative
darstellen könnte, da es damit möglich ist, den Wechselstrom von bis zu drei
Lichtspulen einer umgebauten Magnetzünderanlage getrennt gleichzurichten. Die
Lichtspulen werden hierzu massefrei auf der Primärseite der Diodenplatte angeschlossen.
Da hier nur insgesamt drei Pole vorhanden sind, wird jeweils ein Leitungsende
vom Lichtanker 1 und 2 gemeinsam an einen Gleichrichterpol angeschlossen. Problematisch
ist natürlich die Begrenzung des Ladestroms auf ca. 2 Ampere und der Spannung
auf Werte von nicht mehr als 14,5 Volt. Dies ist aber eine Eigenart aller Polradlichtanlagen,
da diese über Permanentmagnetkerne verfügen, deren Rotor-Magnetfeld nicht wie
bei einer Lichtmaschine über eine Feldspule mit Regler beeinflusst werden kann.
Sachs hat hierzu damals für die
Originalanlage folgendes Verfahren gewählt: Im Schaltzustand "Scheinwerfer
aus" wurde ein Teil des Ladestroms über einen Leistungswiderstand (ca.
2 Ampere) "verbraucht". Sobald das Zündschloss eine Stellung weiter
gedreht wurde, wurde mit dem Einschalten des Lichts gleichzeitig die Verbindung
zum Lastwiderstand abgeschaltet. Diese Lösung wurde in der Anfangsphase der
W 2000 noch insoweit erweitert, als dass nur eine Amplitude der Wechselspannung
über den Gleichrichter ins Bordnetz eingeleitet wurde. Der Ladestrom hielt sich
dabei stets in einem für die Batterie günstigen Bereich von ca 2 Ampere. Allerdings
war diese Lösung betriebsuntauglich, da für Lichtfahrten mit H-4-Scheinwerfer
nicht genug Strom zur Verfügung stand und sich die Batterie rasch entlud. Daher
wurde die Schaltung generell von Sachs geändert, so dass dann beide Amplituden
der Wechselspannung über den Gleichrichter geleitet wurden. Damit stieg der
Ladestrom beim Betrieb ohne Licht mit Spitzen von bis zu 4,5 A fast zu hoch
an, bei Lichtfahrten reichte es geradeso aus, wenn man die Drehzahlen hoch genug
hielt. Erst durch den Einbau einer zusätzlichen Spule mit 23 Watt bei den letzten
W-2000-Modellen besserte sich die Situation ein wenig! Noch problematischer
war bei der W 2000 generell, dass zwischen Lichtankern und Verbrauchern keinerlei
Sicherungen eingebaut waren. Die vorhandenen beiden Sicherungen wirkten nur
zwischen Batterie und Verbrauchern - eine aus Elektrikersicht nicht durchdachte
Konstruktion, die zwangsläufig zur Häufung von Gleichrichterschäden führen musste!
Die Lösung mit Lastwiderständen
wäre auch bei dem Umbau auf 2 Lichtanker mit je 100 Watt anwendbar, jedoch entsprach
sie eigentlich nicht meinen Vorstellungen von einer "ausgereifteren"
Ladestrombegrenzung. Aus einer defekten Drehstromlichtmaschine vom VW-Käfer
baute ich die intakte Diodenplatte aus (gekühlt belastbar bis ca. 800 Watt).
Da die Kühlkörper dieser Platte Strom führend sind, sollten sie elektrisch isoliert
werden, um einen versehentlichen Kontakt zur Fahrzeugmasse auszuschließen.
|
Die Diodenplatte passte zufällig
exakt in einen Kunststoffdeckel, wie er zum Verschließen von Heizöltanks
verwendet wird. Mit diesem Isolationskörper als Zwischenelement wurde
die Diodenplatte unter dem rechten Seitendeckel neben der Batterie befestigt.
Außerdem wurde zwischen Diodenplatte und jeder Ladespule je eine Sicherung
(8 A) eingebaut. Zwei daneben montierte Arbeitsstromrelais übernehmen
jetzt die Aufgabe der Spannungsregelung: Bei Betrieb ohne Licht trennen
die beiden Relais je eine Stromrichtung jeder Spule, d. h. es steht dann
nur jeweils eine Amplitude der Wechselspannung aus beiden Spulen zur Verfügung.
Um ein Trennen zu ermöglichen,
mussten 2 der versteckten Verbindungsdrähte in der Diodenplatte durchbohrt
werden. Diese Lösung eignet sich praktisch mit leichten Abwandlungen für
alle Generatorversionen: 100 Watt original, 123 Watt oder 200 Watt! Wer
Interesse an einem Nachbau hat, kann sich gerne mit mir in Verbindung
setzen.
|
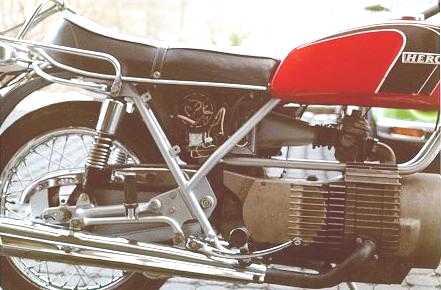
Ansicht auf die neu gebaute Diodenplatte (über
dem hellen Startrelais) und den verbesserten Kettenschutz |
| Die
bei ersten Messungen gewonnen Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass eine
Überladung der Batterie nicht zu erwarten ist, da sowohl die Ladestromstärke
sinkt, als auch die Spannungsspitzen abgefangen werden. Näheres wird sich
im Fahrbetrieb zeigen. Ich werde jedoch versuchen, eine für Wechselstromlichtmaschinen
geeignete elektronische Regeleinheit zu bekommen.
Die originale Magnetzünder-Lichtanlage
verbesserte ich im Februar 2002 noch weiter:
Die Spule des Magnetzünders und der Kondensator wurden abgeklemmt. Stattdessen
wurde eine 23-Watt-Zusatzspule aufgeschraubt und mit der zweiten Primärseite
der Diodenplatte verbunden. So stehen insgesamt 123 Watt an Generatorleistung
zur Verfügung (später soll statt der 23-Watt-Spule eine zweite 100-Watt-Lichtspule
eingebaut werden, die ich z.Zt. noch nicht habe). Statt der originalen
Mini-Zündspule vom Moped wurde in das Rahmendreieck eine PKW-Zündspule
eingebaut. Die Zündschaltung wurde so geändert, dass Zündspule und Unterbrecher
nach Einschalten der Zündung Batteriestrom erhalten (Umstecken des blauen
Kabels von Kurzschluss-Klemme 2 auf 49 a am Zündschloss, gleichzeitig
Herausziehen des blauen Stranges aus dem Kabelbaum zwischen Zündspule
und Generatoranschluss, Anklemmen direkt an Klemme 15 der Spule, usw.).
Ferner wurde eine vom Unterbrecher gesteuerte elektronische Zündanlage
(Typ ZTK 1 von Firma
Laubersheimer) dazwischen geschaltet.
Der Elektrodenabstand der
Zündkerze wurde von 0,4 auf 0,6 mm geändert. Jetzt steht bereits bei Startdrehzahl
ein optimaler Zündfunke zur Verfügung! Zudem fließt über den Unterbrecher
nur noch ein minimaler Steuerstrom, der Kontaktverschleiß wird somit fast
auf Null verringert. Der Motor springt besser an, läuft durch die optimierte
Zündung bereits im Standgas wesentlich runder als zuvor und nimmt sauberer
Gas an.
Kleiner Nachteil: beim Umschalten des Zündschalters auf "Licht ein"
wird der Zündstrom konstruktionsbedingt am Zündschloss kurz unterbrochen.
Hier gibt es noch etwas daran zu verbessern, ggf. durch Einbau eines BMW-Zündschlosses
...
Im April 2002 erhielt ich noch
eine weitere 100-Watt Lichtspule und rüstete daher auf 2 Spulen mit je
100 Watt um. Obwohl die Leistung sich insgesamt dadurch prozentual stark
erhöht hat, ist das Ergebnis nach wie vor bei Dauerfahrten mit Licht nicht
hinreichend befriedigend. Bei Schleichfahrten mit niedrigen Drehzahlen
(Stadtverkehr/Stop and Go) gibt es immer noch ein Batterie-Defizit, allerdings
wird dies recht schnell wieder nachgeladen. Eine Drehstromlichtmaschine
wie bei BMW wäre hier die bessere Wahl, ist aber bautechnisch kaum unterzubringen,
da dann kein Platz für den Zündkontaktsatz mehr verbleiben würde.
|
Im übrigen verlegte ich noch ein
neues Stromkabel von der Batterie zum Scheinwerfer (extra "fliegende"
Sicherung, etwas größerer Drahtquerschnitt, da die Hercules-Konstruktion hier
zu dünn dimensioniert war), damit die Leitungsverluste minimiert werden. Der
Verlauf von Kupplungs- und Gaszug wurde jeweils auf die andere Rahmenkopfseite
getauscht, damit die Seilzüge mit geringeren Knickwinkeln arbeiten. Der Bremslichtschalter
wurde gegen ein Produkt aus dem BMW-Boxerteileprogramm getauscht. Der BMW-Schalter
arbeitet seitenverkehrt, d. h. er wird jetzt über eine Zugfeder aktiviert, die
an der Rückhaltestange der Bremstrommel angehängt ist. Die bei allen Hercules-Fahrzeugen
typischen Schalterbrüche bei der Hinterraddemontage dürften durch diese Änderung
jetzt für alle Zeiten zu vergessen sein! Die serienmäßig viel zu kurze Trittfläche
des Kickstarters verlängerte ich durch Anschweißen eines Stücks Rundstahl um
8 cm. Zudem wurde der Anstellwinkel des Starters durch Aufbringen eines Schweißpunktes
am Startergelenk optimiert. Jetzt besteht kaum noch Verletzungsgefahr durch
Abrutschen des Fußes beim Antreten.
Da meine W 2000 zur ersten Bauserie
gehört, ist sie ab Werk noch mit der 7-Scheiben-Sintermetall-Ölbadkupplung ausgestattet.
Die späteren W 2000 hatten stattdessen eine 5-Scheibenkupplung mit nichtmetallischen
Reibbelägen. Die neuere Kupplung stammt von KTM und zeichnet sich durch ein
besseres Schaltverhalten (besseres Trennen) aus. Über die Wankel-IG konnte ich
einen Satz dieser verbesserten Beläge als Gebrauchtteil ergattern, den ich Mitte
Februar 2002 einbaute. Bei dieser Gelegenheit wechselte ich auch die Getriebeölfüllung.
Durch die Nachfüllöffnungen des Getriebes kann man mittels Leuchtstab auch den
Kegeltrieb der Primärwelle anschauen. Am Kegeltrieb gibt es 2 Markierungen,
die die richtige Positionierung der beiden Kegelräder festlegen. Leider stimmten
die Markierungen bei meiner Maschine nicht überein! Der Grund liegt wohl darin,
dass der Motor vom Vorbesitzer einmal ausgebaut worden war und beim späteren
Zusammenbau die Einstellung nicht beachtet wurde.
Nach längerer Überlegung entschied
ich mich dafür, den Kegeltrieb neu einzustellen. Dafür muss der Motor vom Getriebe
gelöst, und die Zahnräder müssen dann gegeneinander verdreht werden, bis sie
richtig fluchten. Das Problem an der Sache ist nur, dass man dann eigentlich
die Runddichtringe zwischen Motor und Getriebe ersetzen müsste ... Auf deren
Neueinsatz habe ich jedoch verzichtet, Undichtigkeiten sind bisher ausgeblieben.
Allerdings nahm ich auf der Kupplungsseite zur Montage selbst dichtende Muttern
aus dem VW-Ersatzteilprogramm (Spezialmuttern für Käfer-Ölpumpe), baute an jedem
Stehbolzen nur eine Distanzscheibe ein, die zudem mit Curil angeklebt wurden.
Beim Montieren des Kupplungsdeckels stellte ich dann noch fest, dass der Runddichtring
der Kickstarterwelle samt Distanzbuchse wohl bereits beim Vorbesitzer abhanden
gekommen waren. Hierfür fand ich jedoch passenden Ersatz.
|
Am 1. März 2002 war es dann
soweit: Die Maschine wurde dem TÜV vorgestellt.
Die Begutachtung verlief
unproblematisch, anschließend wurde das Motorrad sofort angemeldet, und
ich konnte zur ersten Probefahrt starten. Die Ausstellung des neuen Fahrzeugbriefes
war nicht ganz einfach, weil die Computeranlage der Zulassungsstelle die
exotische Kombination von Wankelmotor und Kraftrad nicht verarbeiten konnte.
Da wurde wirklich mit allen Tricks gearbeitet, um die Daten letztendlich
richtig im Dokument unterzubringen!
Einige technische Mängel
stellten sich bereits auf den ersten Kilometern heraus: Die Gabeldichtringe
wurden erneuert. Ferner rutschte die Kupplung bei ca. 5000 U/min anfangs
stark durch, da der Kuppelstift etwas zu lang war, so dass die Kupplungslamellen
nicht vollständig anliegen konnten.
|

Die Hercules nach dem Zusammenbau:
Die W-2000-Aufkleber auf den Seitenteilen fehlten hier noch. |
| Es
wurde daher im rechten Gehäusedeckel durch Ausfräsen etwas mehr Platz für
den Kupplungshebel geschaffen, so dass die Kupplung besser einrasten kann.
Außerdem wurden die Kupplungsfedern eine Umdrehung mehr vorgespannt. Seitdem
tritt das Durchrutschen nur noch ganz selten auf, was nicht mehr weiter
stört. Anfangs war die Maschine zwischen 60 und 100 km/h im Gabelbereich
trotz richtiger Ölsorte, Reifenauswuchtung und Lenkkopflagereinstellung
noch recht unruhig (Schwingungen um die Lenkachse bei schlechten Straßenverhältnissen),
was nach Montage eines neuen Metzeler-Reifens, Typ ME 11, 3.25-18
auf dem Vorderrad behoben war. Durch Montage von Stabilisierungsgewichten
in den Lenker-Enden wurden die Lenkeigenschaften weiter verbessert - die
Maschine fährt sich jetzt auch auf schlechten Straßen weitgehend pendelsicher.
Mit dem Motorrad habe ich von März bis November 2002 rund 3.200 km nahezu
störungsfrei zurückgelegt. Einmal gab es einen kleinen Ausfall bei einer
Fahrt nach Marburg wegen einer verkokten Zündkerze, was jedoch schnell behoben
werden konnte.
Auch die regenreichen Fahrten
zu den
Wankel-Jahrestreffen
hat sie mangelfrei überstanden!
Im Frühjahr 2003 habe ich die Lichtmaschinenleistung durch Einbau von
zwei elektronischen Reglergleichrichtern optimiert (von Firma MZ-B, Berlin
- siehe meine spezielle Webseite zum Lima-Umbau), so dass seitdem auch
tagsüber ohne Batterieentladung mit Licht gefahren werden kann. Außerdem
habe ich die Ansauggeräuschdämpfung des Luftfilters verbessert. Im Frühsommer
2003 wurden die im Laufe der Jahre etwas erlahmten Kupplungsfedern durch
Neuteile (verstärkte Version) ersetzt. Seitdem ist das Kupplungsschleifen
unter Volllast nicht mehr aufgetreten.
Schwierigkeiten gab
es von August bis Oktober 2003 mit dem Zündsystem. Häufig traten merkwürdige
Zündaussetzer beim Fahren auf. Ein Test-Austausch von Kontaktsatz, Zündschloss,
Kabeln, Zündspule, Kerzenstecker, etc. brachte keinen Erfolg, alle Teile
waren in Ordnung. Auch das Kraftstoffsystem wurde überprüft - es waren
keine Fehler erkennbar. An manchen Tagen lief die Maschine über mehrere
100 km störungsfrei und am folgenden Tag konnte es vorkommen, dass sie
noch nicht einmal ohne diverse herbe Aussetzer den ersten Kilometer überstand.
Die Ursache ließ sich erst Mitte 2004 lückenlos klären. Der Grund
lag in dem geringen Steuerstromfluss der damals verwendeten kontaktgesteuerten
Zündelektronik. Durch den geringen Stromfluss werden Ablagerungen
auf den Unterbrecherkontakten nicht zuverlässig weggebrannt, wie
es bei einer analogen Batteriezündung der Fall ist.
Im Frühjahr 2005 wurde
die Zündanlage komplett überarbeiten und gleichzeitig optimiert. Ich habe
ein kontaktloses System eingebaut, wobei ich Bauteile aus dem Nachrüstangebot
für Oldtimer-PKW verwendet habe. Das winzige Zündelektronik-Bauteil
arbeitet kontaktlos und ist unter dem Abschlussdeckel des Lüftergehäuses
untergebracht. In der Folge konnte ich die Lichtmaschine vollkommen umbauen.
Durch den Wegfall des Kontaktsatzes ergab sich Platz für den Einbau
einer dritten Ladespule, so dass jetzt eine Drehstromschaltung möglich
wurde. Dies verbessert die Ladebilanz des Generators erheblich!
Außerdem
habe ich Ende 2004 das Motorrad auf Getrenntschmierung umgebaut, wobei
der Öltank von der Wankel-Injection verwendet wurde.
Bis Mitte 2006 ist
der Kilometerstand auf über 15.000 angewachsen!
Ich suche übrigens noch
Motor-Verschleißteile, wie Lager, Dichtungen, etc., auch einige Fahrwerksteile
oder einen kompletten Motor als Teileträger.
|
|
Einen wichtigen Warnhinweis möchte ich an
dieser Stelle noch an alle W-2000-Fahrer richten:
Die aus südländischen Gefilden
stammende Tankdeckel-Konstruktion der W 2000 lässt erhebliche sicherheitstechnische
Bedenken aufkommen. Der Deckelschließer besteht nur aus einem winzigen
Blechwinkel, der sich zudem bereits unter normalen Betriebsbedingungen
verbiegen kann, insbesondere, wenn der Deckel mit erhöhtem Kraftaufwand
(d. h. nicht gefühlvoll) geschlossen wird. Auf der gegenüberliegenden
Scharnierseite sind ebenfalls nur zwei kleine Blechzungen vorhanden, in
deren Achse zudem gerne etwas Spiel wegen der Deckelvorspannung auftritt.
Schon bei meiner ersten W 2000 neigten sowohl die abschließbaren
als auch die "normalen" Tankdeckel während der Fahrt zum Aufspringen.
Bei meiner heutigen Maschine ist das gleiche
Problem direkt wieder auf einer der ersten Fahrten aufgetreten: der Deckel
sprang nach dem Tanken auf und einiges von der Benzinbrühe ergoss sich
über Tank, Getriebe und Motorradkombi. Mich störte weniger der etwas unangenehme
Geruch, als die Vorstellung, was daraus geworden wäre, wenn zufällig Benzin
auf den heißen Auspuffkrümmer gelangt wäre ... Zudem: was ist bei einem
Sturz oder Zusammenstoß? Zwar lässt sich das Problem des Aufspringens
während der Fahrt durch sorgfältiges Ausrichten am Deckel weitgehend eliminieren,
doch Unfallsicherheit bietet dieser Deckel nicht!
Der W-2000-Tankdeckel, der sich damals übrigens
auch an einigen italienischen Maschinen fand, ist konstruktiv noch
schlechter zu bewerten, als die früheren Bajonett-Verschlüsse der Mopedtanks!
Selbst diese galten damals schon als sicherheitstechnisch überholt. Nur
BMW konnte sich schon in den 1970er Jahren zu einem modernen, versenkten
Deckel durchringen, der auch aus heutiger Sicht noch genügend Brandschutz-Sicherheit
bei Unfällen bietet. Auch hinsichtlich der Deckelbelüftung ist bei der
W 2000 während der Produktionszeit keine Optimierung erfolgt. Die Belüftungsbohrung
ist so klein, dass der Deckel noch lange Zeit nach dem Abstellen der Maschine
zischt, d. h. es ist zu vermuten, dass im Fahrbetrieb ungünstige Druckverhältnisse
die ausreichende Zufuhr von Kraftstoff mit beeinflussen können. Man kann
das Innenteil des Deckel durch Drehen unter Fingerdruck herausnehmen und
danach die Belüftungsbohrung(en) auf hinreichenden Durchgang überprüfen
(Rost und Schmutz beseitigen, ggf. Bohrung leicht vergrößern).
Weitere Hinweise zur Ersatzteilbeschaffung
finden sich in meiner
Vergleichstabelle.
Copyright 2001-2006:
Wolfgang
Dingeldein - aktualisiert am
30.08.2006
|
 |
Die Hercules im Zustand vor dem
Öltank-Anbau;
hier mit Speed-7-S-2000 Lenkerverkleidung
|
Zurück
zur Auswahlseite Wankel 2000